Im Gespräch. Ein Auszug aus einer Unterhaltung zwischen Wolfgang Müller-Funk und Regisseur Sarantos Georgios Zervoulakos über Rache und Opfer, Traum und Orakel sowie Schuld und Versöhnung.
Agamemnon hinterlässt nach seinem blutigen Tod ein zerrüttetes Königshaus. Auf dem Thron sitzen seine Mörder: die von Albträumen geplagte Witwe Klytämnestra und Ägisth. Die lebenshungrige Tochter Chrysothemis hofft auf Hochzeit und Gründung einer neuen, glücklicheren Familie. Orest, auf den die Pflicht der Rache des väterlichen Tods fällt, wird in sicherer Entfernung zum Hof gehalten. Und inmitten dieses vom Trauma beherrschten Familienkonstrukts hält Elektra, Tochter des Ermordeten, brodelnd Mahnwache.
Müller-Funk: Es gibt zwei zentrale Veränderungen bei Hofmannsthal gegenüber der antiken Vorlage von Aischylos. Das eine ist die vollständige Veränderung des Chores und seiner Funktion und das andere ist, dass diese Figuren jetzt Individuen mit ganz bestimmten Eigenarten sind. Was aber bleibt, ist die Frage der Rache, nämlich dass darum gerungen wird, dass man den Einsatz von Gewalt legitimieren muss. Und dass man zu einem Ende kommen will – also diese humanistische Idee der Überwindung der Rache, die den großen Nachteil hat, dass sie sich letztendlich gegen einen selbst richtet.
Zervoulakos: Die Gewalt und die Tatsache, dass man aus dieser Schleife nicht herauskommt, sind bei Hofmannsthal zentral. Die Schleife an sich ist ein Begriff aus der Psychologie, mit dem wir auf der Probe viel arbeiten und der die familiäre Situation, in der die Figuren sich befinden und die Schuld seit gefühlten Ewigkeiten durch den Raum schieben, sich gegenseitig ständig damit quälen, gut beschreibt.
Dazu kommt der Umgang mit unterdrückter Erotik, der sicherlich inspiriert ist von dem Kosmos bürgerlicher Frauen dieser Zeit, dem sich auch Freuds Studien zentral widmeten. Aber auch das Schicksal homosexueller Menschen, die ihre Natur nicht ausleben durften, floss in Hofmannsthals Schreiben ein.
Müller-Funk: Hofmannsthal bietet das für die Zeit der Wiener Moderne Aktuellste an Psychologie auf. Es gibt mehrere Dialoge, in denen Übertragung, autotherapeutische Momente stattfinden, in welchen Nähe und Distanz permanent wechseln. Das ist am stärksten zwischen Klytämnestra und Elektra. Hass und Liebe, also Ambivalenz, was für Freud ja ein Charakteristikum menschlicher Sozialisation in der Familie ist, das wird alles durchgespielt.
Ein bisschen tritt das Hinterfragen der Rache zurück. Dass für Menschen, die in einer Opfergesellschaft leben, der Einsatz von Gewalt eigentlich selbstverständlich ist, und dass Rache eine Form von Gerechtigkeit ist, das ist ja genau etwas, was wir heute infrage stellen.
Zervoulakos: Die Rache und diese selbstauferlegte Denkmalpflege, die Elektra betreibt, sind ein Projekt – ihr Projekt – mit dem sie ganz grundsätzlich den gesicherten Erhalt ihrer Identität verbindet. Und es kommt unweigerlich der Moment, in dem zur Frage steht, ob durch die Auflösung der Situation, durch „das rechte Blutopfer“, dieses Projekt gefährdet ist: Ich habe mein Leben, mein Dasein in dieses Projekt investiert. Gibt es danach überhaupt noch etwas für mich?
Müller-Funk: Also aktuell ist natürlich die Rache immer, denn wir spüren spontan, wenn wir beleidigt oder gekränkt worden sind, Racheimpulse: Dem zahle ich das heim! Das ist ein Impuls, der immer noch wirksam ist. Die einzige Chance, die wir haben, ist, damit umzugehen. Und das macht Psychoanalyse zu einem wichtigen Reflexionsinstrument. Wenn wir ein Trauma erlitten haben, dann arbeiten wir nicht autodestruktiv daran, diese Gewaltspirale weiter zu drehen, sondern daran, zu einem Ende zu kommen.
Der Vater stachelt Elektra sozusagen im Unterbewusstsein an, die Instanz des Überichs sagt: Wenn du eine folgsame Tochter bist, musst du Klytämnestra und Ägisth töten. Der Tötungsimpuls geht von der patriarchalen Instanz aus.
Zervoulakos: Elektra ist eher mit der Interpretation eines Lebens ihres Vaters beschäftigt als mit dem der Mutter.
Müller-Funk: Ich frage mich, ob Hofmannsthal davon ausgehen konnte, dass das zeitgenössische Theaterpublikum die Vorgeschichte kennt. Denn die Geschichte beginnt ja eigentlich damit, dass Agamemnon die dritte, jüngste Tochter, Iphigenie, auf Druck des griechischen Heeres opfern musste. Und er kehrt zurück als Sieger und bringt eine Zwangsgeliebte, Cassandra, mit sich. Das ist der Hintergrund des Mordes an Agamemnon durch Klytämnestra. Der Auslöser für die Situation im Stück ist also nicht Elektra.
Zervoulakos: Ja. Es ist selten der Fall, dass man zu aufgeladenen dramatischen Szenen kommt, die sich nicht mit etwas beschäftigen, das in der Vergangenheit liegt.
Müller-Funk: Mutter und Tochter haben ungewollt Ähnlichkeiten. Und diese Ähnlichkeit führt dazu, dass man das, was man an sich selbst nicht akzeptiert, gegen den anderen richtet. Das verstärkt, beschleunigt noch die Gewalt. Wir begegnen ja am Ende Elektra als einem zerstörten Menschen. Das ist kein Ausweg, den man finden könnte. Damit ist diese Aktion in einem ganz anderen Sinn tragisch, nämlich für sie selbst. Es ist keine Versöhnung mit den anderen denkbar.
Zervoulakos: Vielleicht mit sich selbst. Wir haben uns die Welt der Traumdeutung als Inspiration genommen, das Ganze auch durchaus etwas anders zu lesen: Zum Beispiel bedeuten Todesfälle in der Logik der Traumdeutung, dass sich ein Rollenwechsel im realen Leben anbahnt – oder anbietet.
Müller-Funk: Die Träume sind hier eher freudianisch als antik. Die Träume in der Antike haben meistens einen sehr prognostischen Aspekt. Das ist bei Freud ganz in den Hintergrund getreten. Es ist immer die unbewältigte Vergangenheit, die sich zu Wort meldet, in diesen Albträumen, von denen vor allem die Frauen heimgesucht werden.
Zervoulakos: Ich mag auch die Idee vom Orakel: Man ist als Mensch dazu aufgefordert, sich selbst Richtungen zu formulieren aus dem, was einem dort an Informationen zugespielt wird. Das ist ein Schritt in eine Selbstständigkeit. Eine gegenwärtige Psychologie würde auch immer sagen: Hör auf, die anderen verändern zu wollen, verändere dich, daran kannst du arbeiten. Mich reizt es, eine Version zu finden, in der es auch eine Option einer Lösung – eines Eingriffes – geben könnte.
Müller-Funk: Da fällt mir natürlich die kathartische Wirkung ein, die Aristoteles dem Theater zugebilligt hat. Und man weiß, dass Freud von dieser Idee fasziniert war und seine eigene Therapie in diesem Sinne gesehen hat. Diese Katharsis kommt in dem Stück nicht zustande, aber die Aktualität des Stückes könnte in der Frage liegen: Was ist die Bedingung der Möglichkeit für eine Versöhnung in einem so schrecklichen Kopf? Gibt es das überhaupt?
Das gilt ja für die kollektive Ebene genauso: Wir können nach Palästina schauen, in die Ukraine, nach Russland… Was sind die Bedingungen der Möglichkeit, nicht nur einen militärischen Frieden zustande zu bringen, sondern eine Aussöhnung, in der nicht alles vergessen wird, aber in der sich etwas öffnen kann?
»Gerade in der Gegenwart, in der sehr stark ausformulierte Opfernarrative kursieren, interessiert mich auch zu erzählen, wie man sich aus diesem Zustand heraus bewegen könnte.«
Sarantos Georgios Zervoulakos
»Diese Opfernarrative gehen also sehr weit und man übersieht die Falle, die Opfernarrative immer darstellen, denn ein Opfer zu bleiben ist genauso, wie ein Kind zu bleiben.«
Wolfgang Müller-Funk
Zervoulakos: Grundsätzlich beschäftigt mich die Möglichkeit, am Familiensystem im Kleinen die Gesellschaft im Großen spiegeln zu können. Nach dem Tod des Vaters ist das System aus den Fugen geraten. Beteiligte suchen neue Rollen. Das Ganze muss erstmal völlig durcheinander geraten, um sich neu zu ordnen. Nur ist dieses Familiensystem in dieser Übergangsphase hängen geblieben. Es gibt eine gewisse Form von Handlungsnot und Zeitdruck. Eine Option könnte heißen: Wir müssen uns für eine neue Rolle bereit machen, auch Elektra. Es ist auch ein Erwachsenwerden, das beschrieben ist. Sie tritt aus dieser Kinderrolle heraus, in dem Moment, in dem sie sich aus diesem ständigen, gepflegten Kontakt zum Vater emanzipiert.
Gerade in der Gegenwart, in der sehr stark ausformulierte Opfernarrative kursieren, interessiert mich auch zu erzählen, wie man sich aus diesem Zustand heraus bewegen könnte. Das hat natürlich seinen Preis.
Müller-Funk: Wir sagen, wir leben nicht in einer Opfergesellschaft, das Opfer ist ad absurdum geführt worden, schon durch das Christentum, aber wir operieren in persönlichen, aber auch in politischen Beziehungen immer mit dem Opfernarrativ. Das passiert auch im Stück. Klytämnestra fühlt sich als Opfer des Agamemnon, so wie Elektra sich als Opfer von Klytämnestra empfindet.
Es gibt ja sehr aggressive politische Gruppen im Augenblick, die ich für sehr bedrohlich für den Erhalt der Demokratie halte, die immer Opfer sind. Sie greifen an und sagen dann: „Wir sind die eigentlichen Opfer, wir sind marginalisiert, das System ignoriert uns. Nicht einmal unsere Wahrheit dürfen wir sagen.“ Diese Opfernarrative gehen also sehr weit und man übersieht die Falle, die Opfernarrative immer darstellen, denn ein Opfer zu bleiben ist genauso, wie ein Kind zu bleiben.
Die Autoren der Wiener Moderne sind geprägt auf diesen Konflikt mit der Vaterfigur. Ob bei Kafka oder anderen, immer ist es der Konflikt mit dem Vater, der die symbolische Ordnung, die im Niedergang befindlich ist, repräsentiert.
Zervoulakos: Ich denke, das steht auch mit dem politischen System der Zeit im Zusammenhang. Das war eine Gesellschaft, die im Kaiser eine Art Übervater hatte. Diese kaiserliche Familie hatte natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion.
Müller-Funk: Um den Österreichern das Ende der Monarchie sozusagen schmackhaft zu machen, musste der Präsident eine Art Wahlkaiser sein. Die ungeheure Macht, die Van der Bellen heute hat, verdankt sich diesem Übergang. Wenn heute ein Präsidentenamt geschaffen wird, ist das nur ein Bauchredner, der auf das Einhalten der Werte und Menschenrechte achtet wie ein Schiedsrichter. Aber die frühen Präsidenten der Demokratien sind immer noch so ein Art Königsersatz. Im Augenblick bin ich sehr froh, dass es so ist.
Du hast gesagt, das System ist durch den Tod des Monarchen, den Todes Vaters, vakant. Es hat eine offene Stelle.
Zervoulakos: Man würde im klassischen Prinzip von Königin/König und Prinz/Prinzessin nach der Logik der Erbfolge denken. Ob man jetzt die Schuld erbt oder Materielles, ist im Stück relativ gleichgesetzt. Wir machen im Schauspiel die Schuld wirklich zum Objekt. Es geht auch um einen ganz konkreten Raum, auf den man Anspruch erhebt, als wäre es eine Immobilie. Das macht den Konflikt greifbar.
Müller-Funk: Ja, für das Ökonomische und das Moralische gelten die gleichen Werte und Begriffe. Wert ist etwas Moralisches und etwas Ökonomisches. Die Schuld und die Schulden. Schuld ist eine moralische Kategorie.
Zervoulakos: Schulden sind auch etwas, das sich aus der Vergangenheit ins Jetzt hineinzieht und es wesentlich belastet. Ähnlich ist es übrigens mit der Schuld oder der Erbschuld – mein Lieblingsbegriff in diesem gesamten Kontext.
Müller-Funk: Schulden kann man unter Umständen zurückzahlen. Aber bei Schuld geht das nicht so einfach.
Zervoulakos: Ich glaube, das muss man infrage stellen.
Natürlich ist Schuld auch ein Machtmittel, mit dem in diesen Vorgängen gearbeitet wird. Im Persönlichen interessiert mich das immer weniger und ich lasse es immer weniger zu, was nicht einfach ist. Aber es liegt in der Vergangenheit. Um es mit den berühmten Worten aus der „Fledermaus“ zu sagen: Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Das ist die andere Seite der Medaille – und in manchen Fällen auch ein Ziel.
Müller-Funk: Ja. Das ist die andere Seite der Medaille: Die Kinder, die jetzt geboren werden, haben ein Recht darauf, dass sie nicht das Unrecht, das ihre Großeltern oder Urgroßeltern im griechischen Bürgerkrieg, in der Shoah – wo immer auch, ich will das nicht vergleichen – auf sich geladen haben, dass sie diesen Rucksack nicht weiterschleppen müssen. Sie haben ein Recht auf Zukunft und diese Vergangenheit ist auf eine gewisse Weise eingebaut. Es gibt jenseits des radikalen Vergessens und Verdrängens einerseits, und des immer davon eingeholt Werdens und dadurch handlungsunfähig oder ohnmächtig zu sein andererseits, ein tertium dato – es muss etwas Drittes dazwischen geben.
Diese Vergangenheit ändert sich ja auch. Wir erzählen Sie heute schon anders als vor 30, 40 Jahren, als dieser ganze Diskurs um die Vergangenheit des Nationalsozialismus, der Shoah überhaupt erst begonnen hat.
Zervoulakos: Idealerweise kommt es zu einer Umwandlung von Schuld in Verantwortung, das ist etwas anderes. Die Verantwortung ist ein Bereich, in dem man produktiv und kreativ arbeiten kann. In Schuld, finde ich, ist das eigentlich nicht möglich.
Schuld ist da, belastet, bewegt sich manchmal auch im Kreis. Man muss sich ihrer bewusst sein, zB. in Bezug auf den Nationalsozialismus. Aber ich kann als jemand, der auch eine deutsche Familie hat und 1980 geboren ist, wirklich nicht sagen, dass ich mich uneingeschränkt im Stande sehe, diese Schuld so zu tragen, als ob ich selbst dabei gewesen wäre. Ich war es nicht.
Müller-Funk: Ich konnte mit meinem Vater natürlich schon über die Rolle der Wehrmacht sprechen, er hat immerhin zwei oder drei Jahre dort gedient. Und ihn hat das natürlich vollkommen aus den Socken gehoben, wenn ich gesagt habe: „Die Wehrmacht hat Kriegsverbrechen begangen. Nicht nur die SS. Du willst das jetzt entschulden, aber das geht so nicht. Das stimmt einfach nicht.“ Das hat eine Funktion. Aber das ist für meine vierjährige Enkelin weit weg.
Zervoulakos: Da ist ja genau die Frage: Wie überträgt man dieses Gespräch in die Zukunft, idealerweise auf eine kreative Art und Weise, sodass es in der Zukunft immer die Not und die Notwendigkeit gibt, dieses Gespräch weiterzuführen, selbst wenn wir uns nicht mehr auf Zeugen berufen können.
Müller-Funk: Die Verantwortung aufzunehmen, dass nie mehr eine solche Gesellschaft, die das möglich gemacht hat, entsteht – das ist eine Zukunftsaufgabe. Ich will nicht analogisieren, was jetzt in Österreich passiert, aber wir haben schon die Verpflichtung, einer Entwicklung hin zu einer autoritären Ordnung Einhalt zu gebieten.
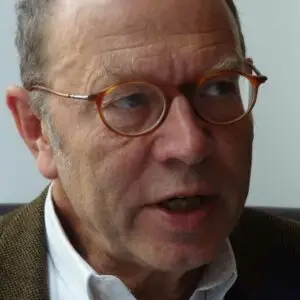 Wolfgang Müller-Funk ist Kulturphilosoph und Literaturwissenschaftler und begleitet das Wissenschaftsprogramm der Wortwiege. Zuletzt erschien: „Crudelitas. Zwölf Kapitel einer Diskursgeschichte der Grausamkeit“ (2022)
Wolfgang Müller-Funk ist Kulturphilosoph und Literaturwissenschaftler und begleitet das Wissenschaftsprogramm der Wortwiege. Zuletzt erschien: „Crudelitas. Zwölf Kapitel einer Diskursgeschichte der Grausamkeit“ (2022)

Sarantos Georgios Zervoulakos ist als Regisseur in Österreich, Deutschland, Griechenland und Italien tätig. Er übersetzt Theaterstücke aus dem Griechischen ins Deutsche, unterrichtet Regie am Max Reinhardt Seminar und gründete 2016 das vielsprachige Theaterkollektiv „Eteria Filon“.